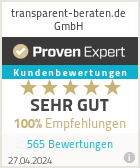Das erwartet Sie hier
Was medizinisch notwendig bedeutet, wie gesetzliche und private Krankenversicherungen darüber entscheiden und welche aktuellen Regelungen gelten.
Inhalt dieser SeiteDas Wichtigste in Kürze
Was bedeutet „medizinisch notwendig“?
Definition des Begriffs
Medizinisch notwendig bedeutet im Kern: Eine Behandlung ist aus Sicht eines Arztes erforderlich, um eine Krankheit zu heilen, zu lindern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern. Der Begriff ist in beiden Versicherungssystemen – gesetzlich wie privat – zentral für die Frage, ob eine Behandlung erstattet wird oder nicht. Dies bedeutet konkret: Nur wenn eine Maßnahme als medizinisch notwendig anerkannt wird, haben Sie einen Anspruch auf Kostenerstattung.
Doch obwohl er überall auftaucht, ist seine Bedeutung nicht einheitlich geregelt. Stattdessen kommt es darauf an, welche Versicherung Sie haben – und wie diese den medizinischen Nutzen einer Maßnahme bewertet. Für Versicherte ist es deshalb entscheidend, die Kriterien und Abläufe zu kennen, um eine Ablehnung zu vermeiden oder erfolgreich dagegen vorzugehen.
Wie sind Sie versichert?
Gesetzliche Krankenversicherung
Die gesetzlichen Krankenkassen halten sich an den Leistungskatalog des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).
Private Krankenversicherung
Die privaten Krankenversicherer prüfen im Einzelfall, ob die Maßnahme im Zeitpunkt der Durchführung ärztlich vertretbar war.
Medizinische Notwendigkeit in der gesetzlichen Krankenversicherung
In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist die Frage, ob eine Behandlung als „medizinisch notwendig“ gilt, nicht dem behandelnden Arzt allein überlassen. Stattdessen regelt ein zentrales Gremium, was erstattet werden darf und was nicht. Versicherte sollten wissen, wer entscheidet, was bezahlt wird und welche Leistungen neu aufgenommen wurden.
Wer entscheidet über die medizinische Notwendigkeit?
Die maßgebliche Instanz für alle Kassenleistungen ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Dieses Gremium aus Ärzten, Krankenkassen und Kliniken legt in den sogenannten G-BA-Richtlinien verbindlich fest, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Arzneimittel, Hilfsmittel oder digitalen Anwendungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.
Grundlage ist das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V: Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein – und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.
Demnach gelten in der gesetzlichen Krankenversicherung nur diejenigen Leistungen, die der G-BA explizit genehmigt, als medizinisch notwendig. Alle anderen Maßnahmen – selbst wenn ärztlich empfohlen – müssen Versicherte aus eigener Tasche zahlen oder auf eine Einzelfallentscheidung hoffen.
Diese Leistungen prüft die GKV über den G-BA
Der G-BA entscheidet unter anderem über die medizinische Notwendigkeit folgender Leistungen:
| Leistungsbereich | Beispiele |
|---|---|
| Diagnostik | CCTA, PET-CT, spezielle Labortests |
| Arzneimittel | GLP-1-Therapien bei Adipositas, Cannabispräparate |
| Therapieverfahren | Psychotherapie, ambulante OPs, neue Strahlentherapien |
| Hilfsmittel und Heilmittel | Hörgeräte, Bewegungsschienen, Physiotherapieformen |
| Digitale Anwendungen (DiGA) | Long-Covid-Apps, Schmerz-Coaches, Schlafprogramme |
Leistungen, die nicht in den G-BA-Richtlinien festgelegt werden, gelten formal nicht als medizinisch notwendig – selbst wenn sie medizinisch sinnvoll erscheinen oder im Ausland Standard sind.
Neue GKV-Leistungen ab 2026
Der G-BA passt den Katalog regelmäßig an den Stand der medizinischen Wissenschaft an. Seit 2026 wurden unter anderem folgende Leistungen neu aufgenommen oder erweitert:
Was bedeutet das für gesetzlich Versicherte?
In der gesetzlichen Krankenversicherung hängt die Erstattung nicht allein von der Diagnose oder der Empfehlung des Arztes ab. Entscheidend ist, ob die Leistung systematisch geprüft und zugelassen wurde. Für viele Versicherte ist das frustrierend – vor allem bei modernen Methoden, die bereits in der Praxis verwendet werden, aber noch nicht offiziell anerkannt sind.
Wenn Sie eine bestimmte Behandlung wünschen, die (noch) nicht erstattet wird, können Sie auf eine Einzelfallentscheidung mit Attest und Begründung hoffen, über eine IGeL-Leistung (Selbstzahlerbasis) gehen oder ergänzend eine private Zusatzversicherung abschließen.
Wie Sie eine Ablehnung vermeiden
Medizinische Notwendigkeit in der privaten Krankenversicherung
In der privaten Krankenversicherung ist der Begriff „medizinisch notwendig“ ebenfalls entscheidend dafür, ob Ihre Behandlungskosten übernommen werden – doch anders als in der gesetzlichen Krankenversicherung entscheidet kein öffentliches Gremium, sondern Ihr behandelnder Arzt und Ihr Versicherer. Der Maßstab ist dabei rechtlich klar definiert, aber auslegungsfähig – und genau das ist Chance und Risiko zugleich.
Was bedeutet medizinisch notwendig in der PKV?
Die Grundlage ist § 1 Abs. 2 der Musterbedingungen für die Krankheitskostenversicherung (MB/KK). Dort heißt es, dass Kosten übernommen werden, wenn es sich um eine „medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen“ handelt. Entscheidend ist dabei die Betrachtung im Voraus: Die Maßnahme muss aus ärztlicher Sicht im Zeitpunkt der Durchführung vertretbar und begründet gewesen sein – unabhängig davon, ob sie rückblickend erfolgreich war oder welche Alternativen bestanden hätten.
Diese Definition wurde in der Rechtsprechung, insbesondere durch den Bundesgerichtshof (BGH), mehrfach bestätigt und konkretisiert:
- Es zählt nicht, ob die Behandlung optimal war, sondern ob sie fachlich nachvollziehbar und individuell gerechtfertigt war.
- Auch alternative oder nicht leitlinienkonforme Maßnahmen können anerkannt werden, wenn der behandelnde Arzt sie sorgfältig begründet hat.
Wer entscheidet über die Leistung und wer prüft?
In der Praxis wird jeder Leistungsfall von der Leistungsabteilung des Versicherers geprüft. Je nach Fallkonstellation kommen folgende Schritte infrage:
- Prüfung durch Fachreferenten oder medizinische Berater im Haus
- Anforderung weiterer Unterlagen, zum Beispiel ausführlicher Arztbericht, OP-Bericht, Therapieplan
- Einschaltung externer Gutachter, besonders bei kostenintensiven oder umstrittenen Verfahren
- Ausschlussprüfung, wenn bestimmte Leistungen tariflich nicht versichert sind
Die Prüfung erfolgt nach Aktenlage – es gibt keine persönliche Untersuchung. Deshalb ist eine präzise medizinische Begründung durch den behandelnden Arzt besonders wichtig.
So argumentieren PKV-Versicherer bei Ablehnung
Kommt es zur Ablehnung einer beantragten Leistung, berufen sich Versicherer häufig auf bestimmte Standardargumente, darunter zum Beispiel:
- Die Behandlung sei nicht wissenschaftlich anerkannt
- Es gebe eine kostengünstigere, gleichwertige Alternative
- Die Maßnahme sei nicht schulmedizinisch begründet
- Es handele sich um keine medizinische Heilbehandlung, sondern um Komfort, Prävention oder Lifestyle
- Die Leistung sei vom Versicherungsschutz ausgeschlossen (zum Beispiel in Basis- oder Beamtentarifen)
In vielen Fällen sind diese Argumente interpretationsabhängig und nicht immer rechtlich haltbar. Besonders bei neuen Verfahren, Medikamenten oder Therapien jenseits der Leitlinien lohnt sich eine kritische Prüfung.
Was bedeutet dies für Privatversicherte?
Für Privatversicherte ist die Definition der medizinischen Notwendigkeit in vielen Fällen vorteilhafter als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn in der privaten Krankenversicherung zählt die Sicht des Arztes und des Versicherers – selbst wenn sie nicht dem allgemeinen Standard entspricht. Das bedeutet: Wer privat versichert ist, hat oft bessere Chancen, auch neuartige oder alternative Behandlungen erstattet zu bekommen – vorausgesetzt, sie sind fachlich nachvollziehbar begründet.
Mit uns die ideale private Krankenversicherung finden
Gemeinsam mit unserem von Finanztip empfohlenen Partner von Buddenbrock können wir Ihnen kostengünstige und leistungsstarke private Krankenversicherungen anbieten:
Typische Streitfälle und Gerichtsurteile
Was Gerichte als medizinisch notwendig anerkennen
Die Rechtsprechung – insbesondere durch den Bundesgerichtshof (BGH) – hat die Anforderungen an die medizinische Notwendigkeit konkretisiert. Laut einem Urteil von 2013 ist eine Behandlung dann medizinisch notwendig, wenn sie aus Sicht eines vernünftigen Arztes im Zeitpunkt der Maßnahme vertretbar erscheint – selbst wenn andere Behandlungsformen möglich oder günstiger gewesen wären. Dennoch kommt es regelmäßig zu Streitfällen zwischen Versicherten und Krankenversicherungen. Einige davon landen vor Gericht – mit wegweisenden Entscheidungen.
Urteile: Was Gerichte entschieden haben
Erstattungspflicht bei Behandlung in teurer Privatklinik
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine private Krankenversicherung grundsätzlich auch dann zur Kostenerstattung verpflichtet ist, wenn eine Behandlung in einer teureren Privatklinik stattfindet, sofern die Behandlung medizinisch notwendig ist. Die Wirtschaftlichkeit ist nicht das alleinige Kriterium.
BGH, Urteil vom 12.03.2003 – IV ZR 278/01
Medizinische Notwendigkeit bei Zahnersatz
Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die medizinische Notwendigkeit einer zahnärztlichen Behandlung nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst zu beurteilen ist und nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Regelversorgung der gesetzlichen Kassen ist nicht automatisch der Maßstab für die medizinische Notwendigkeit in der privaten Krankenversicherung.
BGH, Urteil vom 02.05.2024 – III ZR 197/23
Neue Behandlungsmethoden bei lebensbedrohlicher Erkrankung
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in einem Grundsatzurteil die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für neue, noch nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden bei lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankungen erweitert. Dies geschah unter Berufung auf die Schutzpflicht des Staates für Leben und körperliche Unversehrtheit.
BVerfG, Urteil vom 06.12.2005 – 1 BvR 347/98
Fehlender Nachweis der medizinischen Notwendigkeit
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln entschied, dass eine private Krankenversicherung die Kosten für diverse Schmerzbehandlungen (unter anderem Injektionen, Akupunktur) nicht erstatten muss, wenn die Ursache der Beschwerden nicht adäquat diagnostiziert wurde. Solange nicht geklärt ist, worauf die Beschwerden zurückzuführen sind, kann auch nicht festgestellt werden, dass die Behandlung eine geeignete und somit medizinisch notwendige Therapie darstellt. Die Beweislast liegt beim Versicherten.
OLG Köln, Urteil vom 23.12.2014 – 20 U 7/14
Prothesenwartung als medizinisch notwendige Leistung
Der Bundesgerichtshof urteilte, dass die Kosten für die Wartung einer Beinprothese von der privaten Krankenversicherung erstattet werden müssen. Die Richter stellten klar, dass die Kosten für Hilfsmittel und deren Instandhaltung als zusammengehörige, medizinisch notwendige Leistung anzusehen sind. Es handelt sich bei der Wartung nicht um eine erneute, gleichartige Leistung im Sinne der Versicherungsbedingungen.
BGH, Urteil vom 07.11.2018 – IV ZR 14/17
Typische Streitfälle in der gesetzlichen Krankenversicherung
Moderne Diagnostik ohne G-BA-Zulassung
Viele Patienten wünschen sich frühzeitige und präzise Diagnostik – etwa ein Ganzkörper-MRT zur Abklärung unspezifischer Beschwerden. Solche Verfahren sind in der Regel nicht im Leistungskatalog der GKV enthalten, wenn keine klare Indikation vorliegt. Die Krankenkassen lehnen dann häufig mit Verweis auf das Wirtschaftlichkeitsgebot ab, da es die Frage aufwirft, ob die Maßnahme medizinisch notwendig oder nur medizinisch „wünschenswert“ ist.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)
Apps auf Rezept sind seit 2020 erstattungsfähig, müssen jedoch durch das BfArM zugelassen sein und dürfen nur für definierte Indikationen eingesetzt werden. Da einige Anwendungen ihren Erstattungsstatus wieder verlieren, zum Beispiel nach Ablauf der Erprobungsphase, stellt sich oft die Frage, ob die Krankenkasse weiterhin zahlen muss, wenn der Nutzen der App für den konkreten Patienten bereits erwiesen ist.
Zahnersatz und Zahnbehandlungen
Die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt bei Zahnersatz in der Regel nur die sogenannte Regelversorgung – zum Beispiel eine Brücke statt eines Implantats. Haben Patienten jedoch medizinische Gründe für eine teurere Lösung, etwa bei Kieferverformungen oder Materialunverträglichkeit, ist die Grenze zwischen dem, was medizinisch wirklich notwendig und was vorrangig ästhetisch vorteilhaft ist, oft strittig.
Hilfsmittel mit Komfortmerkmalen
Ob spezieller Rollstuhl, orthopädische Schuhe oder digitale Hörgeräte: die gesetzliche Krankenkasse bezahlt bei Hilfsmitteln in der Regel nur die „zweckmäßige Grundversorgung“. Alles darüber hinaus gilt als Komfortleistung, auch wenn es die Lebensqualität deutlich steigert. Unstimmigkeiten bestehen darin, wo die Grenze zwischen Komfort und tatsächlicher Notwendigkeit verläuft, insbesondere wenn es um die Teilhabe am Alltags- oder Berufsleben geht.
Psychotherapie außerhalb der Regelverfahren
Gesetzlich anerkannt sind derzeit Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie und Psychoanalyse. Andere Methoden, etwa systemische Therapie, EMDR oder Online-Formate, werden oft abgelehnt, selbst wenn sie ärztlich empfohlen sind. Dies führt häufig zu dem Streitpunkt, ob ein alternatives Verfahren nicht doch übernommen werden kann, insbesondere wenn es nachweislich wirksam ist und andere Therapien zuvor gescheitert sind.
Off-Label-Use von Medikamenten
Wenn ein Medikament für eine bestimmte Diagnose zwar medizinisch geeignet, aber nicht zugelassen ist, lehnen gesetzliche Kassen die Erstattung in der Regel ab. Nur bei einer sogenannten „therapeutischen Notlage“ ist eine Ausnahme möglich. Zum Konflikt mit der Krankenkasse kommt es bei der Frage, ob die Notlage wirklich besteht oder ob es andere zugelassene Alternativen gibt.
Typische Streitfälle in der privaten Krankenversicherung
Alternativmedizin und Naturheilverfahren
Viele PKV-Versicherte nutzen homöopathische, osteopathische oder naturheilkundliche Verfahren, etwa zur Schmerztherapie oder als Ergänzung zur Krebstherapie. Ob diese Leistungen erstattet werden, hängt stark vom gewählten Tarif ab. Häufig lehnen Versicherer ab, weil die Wirksamkeit nicht „wissenschaftlich belegt“ sei. Der zentrale Konflikt ist damit der geforderte Nachweis: Versicherer pochen auf evidenzbasierte Studien, während Ärzte und Patienten eine fachärztliche Empfehlung oft für ausreichend halten.
Hilfsmittel mit individueller Anpassung
Hilfsmittel wie maßgefertigte Einlagen, Spezialrollstühle oder digitale Hörgeräte mit Premiumfunktionen werden von der privaten Krankenversicherung gerne auf Basis von Preis-Leistungs-Verhältnissen geprüft. Oft heißt es: „Eine einfachere Variante hätte auch ausgereicht.“ Im Kern geht es bei diesem Streit darum, ob die individuelle Anpassung reiner Komfort ist oder selbst Teil der medizinischen Notwendigkeit.
Reha– und Kurmaßnahmen
Viele Tarife der privaten Krankenversicherung enthalten Reha-Leistungen nur eingeschränkt oder gar nicht. Anschlussheilbehandlungen nach Operationen müssen zudem oft vorab beantragt werden. Wird dies versäumt, entsteht ein typischer Konflikt. Die Versicherung pocht auf den Formfehler, der Patient auf die unaufschiebbare medizinische Notwendigkeit der Maßnahme.
Wenn die PKV nicht zahlt: Das können Sie tun
Das sagen die Statistiken des Versicherungsombudsmanns
Laut dem Jahresbericht 2024 des PKV-Ombudsmanns betrafen 665 der insgesamt 6.129 Schlichtungsanträge (rund 11 Prozent) genau diese Frage: War eine bestimmte Behandlung, ein Medikament oder ein Hilfsmittel medizinisch notwendig im Sinne des Vertrags?
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 12 Prozent. Besonders häufig wurde gestritten über:
- alternative oder komplementärmedizinische Behandlungen (z. B. Osteopathie, Cannabis, orthomolekulare Therapie)
- neue Medikamente wie GLP-1-Präparate zur Adipositastherapie (Wegovy, Ozempic)
- psychotherapeutische Verfahren außerhalb der Richtlinien
- individuelle Hilfsmittelversorgungen, z. B. Spezialrollstühle, digitale Hörgeräte
So lassen Sie die Notwendigkeit vorab prüfen und vermeiden Ablehnungen
Damit eine Behandlung oder ein Hilfsmittel wirklich erstattet wird, ist nicht nur die medizinische Indikation entscheidend, sondern auch die Dokumentation und Kommunikation gegenüber Ihrer Krankenversicherung. Je besser Sie Ihre Leistungsanfrage vorbereiten, desto geringer ist das Risiko einer Ablehnung.
Vier Tipps zur Vorbereitung Ihrer Leistungsanfrage
Schriftliche und ausführliche Stellungnahme vom Arzt
Erklären Sie Ihrem Arzt, dass Ihre Krankenversicherung nur medizinisch notwendige Maßnahmen bezahlt und dass Sie eine sorgfältige Begründung benötigen. Der Arztbrief sollte klarmachen, warum genau diese Behandlung notwendig ist, warum andere Methoden nicht infrage kommen und welche Folgen ein Unterlassen aus seiner Sicht hätte. Formulierungen wie „nach medizinischer Erfahrung zwingend erforderlich“ oder „alternativlos im Hinblick auf die Krankheitsentwicklung“ sind hilfreich. Achten Sie darauf, dass Diagnose, Verlauf und Ziel der Behandlung klar beschrieben sind.
Wann sich ein ärztliches Zweitgutachten lohnt
Gerade bei umstrittenen Behandlungen oder neuen Methoden (zum Beispiel DiGA, GLP-1-Präparate, alternative Verfahren) kann ein unabhängiges Zweitgutachten entscheidend sein. Es erhöht die Glaubwürdigkeit Ihrer Anfrage und signalisiert dem Versicherer, dass die Maßnahme medizinisch vertretbar und keine Privatmeinung ist. Wählen Sie am besten einen Facharzt mit Erfahrung im jeweiligen Gebiet, etwa einen Diabetologen bei Adipositas-Therapie oder einen Schmerztherapeuten bei Cannabis-Verordnungen.
Schriftlicher Leistungsantrag an die Krankenversicherung
Formulieren Sie ein kurzes Anschreiben an Ihre Krankenkasse oder Ihren privaten Krankenversicherer. Hängen Sie Atteste, Arztbriefe und gegebenenfalls Literatur oder Leitlinien bei. Beantragen Sie – wenn möglich – eine vorherige Kostenzusage. Besonders bei stationären Behandlungen, Operationen, Reha- oder Hilfsmitteln empfiehlt sich eine schriftliche Bestätigung vor Beginn der Maßnahme. Achten Sie auf Fristen.
Jeden Austausch dokumentieren und sachlich kommunizieren
Heben Sie alle Schreiben und Rückmeldungen gut auf. Bei einer Ablehnung sollten Sie ruhig und begründet widersprechen, gegebenenfalls mit Unterstützung Ihres Arztes, eines Anwalts oder über die Ombudsstelle.
Was tun bei einer Ablehnung?
Wenn Ihre Krankenversicherung die Kostenübernahme ablehnt, sollten Sie das nicht einfach hinnehmen. Sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung haben Sie das Recht, gegen eine Ablehnung vorzugehen – etwa durch Widerspruch, ärztliche Nachweise oder eine Einschaltung der Ombudsstelle. Wie genau Sie dabei vorgehen und worauf Sie achten sollten, lesen Sie in unserem ausführlichen Ratgeber.
Die häufigsten Fragen zu medizinischer Notwendigkeit
Was ist eine medizinisch notwendige Heilbehandlung?
Eine Heilbehandlung ist medizinisch notwendig, wenn sie zum Zeitpunkt der Behandlung auf der Grundlage objektiver Befunde geeignet scheint, ein diagnostiziertes Leiden zu behandeln.
Wer entscheidet über die medizinische Notwendigkeit?
Normalerweise entscheidet der Arzt, was eine notwendige und angemessene Behandlung ist. Allerdings können Vertreter von Krankenkassen diese Entscheidung überprüfen und zu einem anderen Schluss kommen, weswegen es sich lohnt, vor teuren Eingriffen deren Kostenübernahme abzuklären.
Was ist eine medizinische Begründung?
Manchmal verlangen Krankenversicherungen eine Begründung, wieso eine Behandlung medizinisch notwendig ist, bevor sie sich bereit erklären, die Kosten zu übernehmen. Diese wird in der Regel als Teil des Antrags für die Kostenübernahme von dem behandelnden Arzt geschrieben und enthält eine Beschreibung des Symptoms beziehungsweise der Gesundheitsrisiken und eine Erklärung, wieso die angedachte Behandlung die beste Methode ist, dagegen vorzugehen.
Wann ist Zahnersatz medizinisch notwendig?
Zahnbehandlungen gelten als medizinisch notwendig, wenn die Behandlung dem gegenwärtigen Wissensstand entspricht, dauerhaft wirtschaftlich ist und auf ein gesundheitliches Problem reagiert. Behandlungen, die vor allem kosmetischer Natur sind, fallen nicht darunter. Bei Zahnersatz zahlen gesetzliche Krankenversicherungen in der Regel einen Anteil einer kostengünstigen Variante von Zahnersatz. Für die Verwendung hochwertiger Materialien oder für Implantate kommen sie nicht auf.
Was ist der Unterschied zwischen GKV und PKV bei Leistungsanträgen?
In der gesetzlichen Krankenversicherung entscheidet oft der G-BA über die grundsätzliche Erstattungsfähigkeit, während in der privaten Krankenversicherung die individuelle Vertretbarkeit durch ärztliche Begründung zählt. Die Voraussetzungen und Chancen unterscheiden sich teils deutlich.
Wie stelle ich einen Antrag auf Kostenübernahme richtig?
Sie sollten Ihrer Krankenversicherung ein kurzes, sachliches Schreiben mit einer ärztlichen Begründung beilegen. Wichtig ist, dass die medizinische Notwendigkeit nachvollziehbar erklärt wird. Reichen Sie alle relevanten Unterlagen wie Atteste, Arztbriefe oder Therapiepläne mit ein.
Brauche ich immer ein Attest für eine Leistungsanfrage?
Ein ärztliches Attest oder eine schriftliche Stellungnahme ist in der Regel sehr hilfreich. Es sollte begründen, warum genau diese Maßnahme medizinisch notwendig ist und welche Alternativen ausgeschlossen wurden.
Was passiert, wenn mein Antrag abgelehnt wird?
Dann können Sie Widerspruch einlegen oder eine ergänzende medizinische Begründung nachreichen. Bei der GKV ist ein Widerspruch innerhalb eines Monats möglich, in der privaten Krankenversicherung können Sie sich zusätzlich an den Ombudsmann wenden.
Haben Sie alles gefunden?
Hier finden Sie weitere interessante Inhalte zum Thema:
Schnelle Frage, Kritik oder Feedback?
Wir helfen Ihnen gern. Professionelle Beratung von echten Menschen. Rufen Sie uns zum Ortstarif an oder schreiben Sie uns per E‑Mail.