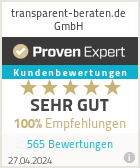Das Wichtigste in Kürze
Das erwartet Sie hier
Was es mit der Rückabwicklung öffentlicher Schutzräume auf sich hat und wo man im Notfall Schutz suchen kann.
Inhalt dieser SeiteWarum werden Schutzräume rückabgewickelt?
Abbau von Schutzräumen seit 2007
Aktuell stehen keine öffentlichen Schutzräume zur Verfügung und es gibt auch keine Pläne für deren Reaktivierung. Da sich die Bedrohungslage, aus der heraus Schutzräume ursprünglich gebaut und erhalten wurden, geändert hatte, fiel 2007 die Entscheidung, das bisherige Schutzraumkonzept aufzugeben. Schutzräume in den Neuen Bundesländern wurden nach der Wiedervereinigung nicht in das Schutzraumkonzept integriert und unterlagen nicht der Zivilschutzbindung.
Rückabwicklung durch die BImA
Seit 2020 ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für die Rückabwicklung der Schutzräume zuständig. Laut BImA sind mittlerweile rund 1400 von 2000 Anlagen rückabgewickelt worden. Bis zur Entlassung aus der Zivilschutzbindung, die zur Zeit nach und nach erfolgt, werden die ehemaligen Schutzräume von den Kommunen bewirtschaftet. Sämtliche Hausschutz- und Schulschutzräume sind bereits aus der Zivilschutzbindung entlassen und rückabgewickelt worden.
Warum stehen keine Schutzräume mehr zur Verfügung?
Grund für die Rückabwicklung der Schutzräume, in denen auch zu Zeiten einer hohen Schutzraumdichte nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Schutz finden konnte, ist eine Veränderung der Bedrohungslage und die Einschätzung von Klimawandel, Naturkatastrophen und Terrorismus als relevanteste Risiken. Bei diesen handelt es sich um Gefahren, vor denen Luftschutzbunker in der Nähe nicht effektiv schützen können.
Laut einem BImA-Sprecher kommt noch hinzu, dass bei den derzeit anzunehmenden Bedrohungslagen keine ausreichende Vorwarnzeit gegeben sei. Menschen hätten also wahrscheinlich keine Zeit, sich nach einer Warnung (z.B. durch Sirenensignale) rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Diesem mittlerweile nur eingeschränkten Nutzen standen die sehr hohen Kosten für den Erhalt der Schutzräume gegenüber – ihre Instandhaltung kostete etwa zwei Millionen Euro pro Jahr.
Was sind öffentliche Schutzräume?
Welche Arten von Schutzräumen gab es?
Neben Mehrzweckanlagen (Tiefgaragen, Bahnhöfe) gibt es sogenannte Schutzräume mittlerer Größe. Dieses sind zum Beispiel Schulschutzräume, ehemalige Hilfskrankenhäuser sowie Bunker und Stollen. Öffentliche Schutzräume werden häufig nach dem Prinzip der Doppelnutzung auch für friedensmäßige Zwecke genutzt, z. B. Katastrophenschutz, Vereine etc. Die Schutzräume waren regional über alle alten Bundesländer verteilt, ihre Nutzung war im Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) geregelt.
Wo finde ich Informationen über öffentliche Schutzräume?
Eine Übersicht über die verschiedenen Schutzraumarten und ihre Anzahl sowie weitere Informationen (ohne Lagedaten einzelner Schutzräume) sind auf der Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter www.bbk.bund.de zu finden.
Alternativen zu Schutzräumen: Das rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
Das empfiehlt das BBK
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geht weiterhin davon aus, dass Bombenangriffe in Deutschland extrem unwahrscheinlich sind. Falls jedoch Schutzräume nötig werden, empfiehlt es, die vorhandenen Gebäude als solche zu nutzen.
Wo ist es am sichersten?
Am meisten Schutz bieten laut BBK innenliegende Räume mit möglichst wenigen Außenwänden, Fenstern und Türen. Außerhalb des eigenen Zuhauses böten sich entweder frei zugängliche Innenräume oder am besten unterirdische Räume wie U-Bahn-Stationen als Alternative an. Weitere Informationen sowie Ratschläge für die Vorbereitung auf und das Verhalten in Notsituationen stellt das BBK auf seiner Website zur Verfügung:
Notsituationen: Leitfäden des BBK